Too long; didn’t read – re:publica 2019 und der Aufruf zu noch mehr Filterblase?
„Wenn Verkürzungen zu simplen Parolen und Slogans werden, die missbraucht werden, um die Gesellschaft zu spalten und demokratische Systeme zu zerstören, müssen wir mit Wissen und Information, mit Empathie, Dialog und Solidarität dagegen halten.“ – re:publica 2019
„tl;dr“ steht eigentlich für zwei Aspekte: es kann im Netz nicht nur Ausdruck von Faulheit beim Leser und Feedback an den Autor sein, sondern auch ein Service an den Leser. Oft wird vom Verfasser eines Beitrags direkt ein „tl;dr“-Satz oder -Absatz mitgeliefert, der die Kernthesen verständlich und auf den Punkt gebracht zusammenfasst. Dieser Aspekt hat mir bei den meisten Vorträgen der re:publica dieses Jahr leider gänzlich gefehlt. Schade.
Die drei Tage Konferenz haben, zumindest bei mir, sehr viel mehr Fragen aufgeworfen als sie zu beantworten. Und das, obwohl sich viele Redner wirklich Mühe gegeben haben, wissenschaftlich fundiert, mit Quellen belegt und möglichst transparent zu präsentieren. Es war aber teilweise einfach zu viel: zu viele verschiedene Gedankenstränge in einem Vortrag, zu viel Uni-Atmosphäre, zu viel abgelesen statt verständlich und mitreißend vorgetragen. Und (wie immer bei der re:publica) zu viele Sessions parallel.
Gemeinsam gegen laut
re:publica ist natürlich immer das, was man draus macht. Und ich habe dieses Jahr viele Sessions und Panels zum Thema Hatespeech, Diskurs im Netz und das Bekämpfen von rechten Trollen besucht. Die beruhigende Nachricht zuerst: Der meiste Lärm von Rechts wird von (nur) circa 4.000 Accounts aus gesteuert, die weitestgehend auch miteinander verbunden sind.
Die schlechte Nachricht: Die Schweigespirale ist in vollem Effekt. Die kleine – aber sehr laute – Minderheit, wirkt für die schweigende, das Geschehen im Netz meist nur beobachtende Zuschauerschaft wie eine Mehrheit. Das beeinflusst die Bereitschaft der Menschen, ihre von der vermeintlichen Mehrheitsmeinung abweichende Meinung öffentlich kundzutun.
Wie können wir dem also entgegenwirken? Wir sollten alle laut und visibel für das einstehen, was uns wichtig ist. Ein einfaches „Das sehe ich nicht so“ unter einem Troll-Kommentar kann schon ein erster Schritt sein. Wir sollten in jedem Fall den rechten Populisten nicht einfach kampflos das Feld überlassen.
Von Monopolen und Filterblasen
In mehr als einem Vortrag wurde die Übermacht Facebooks thematisiert und vor allem scharf kritisiert – bis hin zur Forderung der Zerschlagung des Konzerns in seine Einzelteile (Facebook, Instagram und Whatsapp). Die Plattformen wären vorrangig zur Manipulation (zu Werbezwecken) geschaffen worden. Und die jüngsten Beteuerungen Zuckerbergs, die Netzwerke privater machen zu wollen, schienen Cory Doctorow und Co. ihm nicht abzukaufen. Sogar einer der Mitgründer des Netzwerks, Chris Hughes, forderte jüngst in der New York Times (Video), Facebook wieder kleiner zu machen.
Interessant waren die Lösungsvorschläge, die Doctorow oder auch Bertram Gugel anbrachten: Facebook, Google, Amazon systematisch in die einzelnen Komponenten zerlegen (also zum Beispiel Messenger, Videoplayer, usw.), die Schnittstellen für alle Arten von Content vereinheitlichen und künftig das Aggregieren von Inhalten nicht mehr von nur einer Plattform abhängig machen.
Für die Demokratisierung des Zugangs zu allen Inhalten könne man das Minecraft-Server-Modell als Beispiel nehmen: Die technischen Rahmenbedingungen sind für alle die gleichen, aber Nutzer können sich eigene Server – also eigene Zugänge/eigene Apps/eigene Portale/eigene Gruppen – anlegen, denen sie bestimmte Wertekonstrukte oder Missionen zugrunde legen. Hintergründe zu Minecraft und den Learnings für Unternehmen hat brandeins zusammengefasst.
Ich persönlich finde das einerseits gut. Eine Demokratisierung der Inhalte und der Schnittstellen ist sicher sinnvoll und dazu noch sehr bequem. Außerdem minimiert eine Zerstreuung der Aufmerksamkeit auf mehrere Plattformen oder kleinere Gruppen die Schnelligkeit, mit der sich gefährliche Inhalte verbreiten können.
Allerdings glaube ich nicht, dass der aktuelle Trend hin zu mehr Filterblasen und noch homogeneren Gruppen wirklich der Demokratie, der politischen Aufklärung und der Stimmung im Netz sowie der Stimmung im Land hilft. Hier halte ich es eher mit dem Ansatz, Medien, Page-Betreiber und die Allgemeinheit zu ordentlichem Community-Management zu verpflichten. Sascha Lobos „Realitätsschock“ ist sehr sehenswert. Hier geht es auch um Filterblasen und den Aufruf, hinzusehen, sich zu informieren, mitzureden und aktiv zu werden statt sich weiter in die eigenen Annahmen zu verkriechen.
Was nehmen wir also mit?
Vieles ist gerade im Fluss. Aber meine Empfehlungen für Unternehmen, Marketer und Kommunikatoren sind weiterhin: Konzentriert Euch darauf, Eure eigene Webseite aufzubauen/auszubauen und den inhaltlichen Schwerpunkt dort zu legen. Macht Euch nicht abhängig von sozialen Netzwerken, sondern nutzt sie flexibel für das Teasern Eurer Inhalte und Produkte. So könnt Ihr sicherstellen, dass Ihr jederzeit wisst, welche Marketingaktivitäten welchen Beitrag zu Eurem Geschäft leisten, seht schneller Veränderungen in der Nützlichkeit der einzelnen Aktivitäten oder Plattformen und könnt Euch frühzeitiger um Alternativen bemühen.
Investiert in Community Building und Community Management – gerade hier ist für sehr viele Unternehmen noch sehr viel Luft nach oben. Macht Eure Community aber nicht an nur einer Plattform oder einer Technologie fest, sondern an gemeinsamen Werten, gemeinsamen Veranstaltungen und einem einheitlichen Ton und Erscheinungsbild über alle Kommunikationskanäle hinweg. Denn dann bildet sich eine Community rund um Eure Marke und Eure Themen, die Euch im Fall der Fälle auch auf andere Plattformen folgt – und nicht stirbt, falls Facebook, Twitter oder LinkedIn entscheiden, Ihr Businessmodell morgen zu ändern.
Und zu guter Letzt (bzw. eigentlich immer am Anfang): Setzt eine ordentliche Strategie für Eure Kommunikation auf, die mit genau den KPIs regelmäßig überprüft wird, die tatsächlich für den geschäftlichen Erfolg relevant sind. Good bye, Eitelkeitsmetriken.
tl;dr: re:publica ist das, was man draus macht. Der Besuch 2019 hat sich dank Inspiration, Blick über alle möglichen Tellerränder und Hoffnung auf ein besseres Miteinander gelohnt. Verlasst Euch als Kommunikatoren nicht ausschließlich auf die sozialen Netzwerke. Steht als Menschen transparent für Eure Werte ein.
Die Schau-Empfehlungen
Eva Horn: Wie Populisten uns auf Social Media vor sich hertreiben
Frank Rieger: Cyberwar, hybride Kriegführung, Desinformation
Sascha Lobo: Realitätsschock
Cory Doctorow: It’s monopolies, not surveillance. (ab 8:48:2)
Marcus John Henry Brown: Flex
Luca Caracciolo: „Disruption or Hype?“ – Das Zukunftspotenzial neuer Technologien
Kate Devlin: The Artificial Lover: Our Intimate Future with Machines
Fotocredit: re:publica Eröffnung (c) MCB / Ulf Büschleb

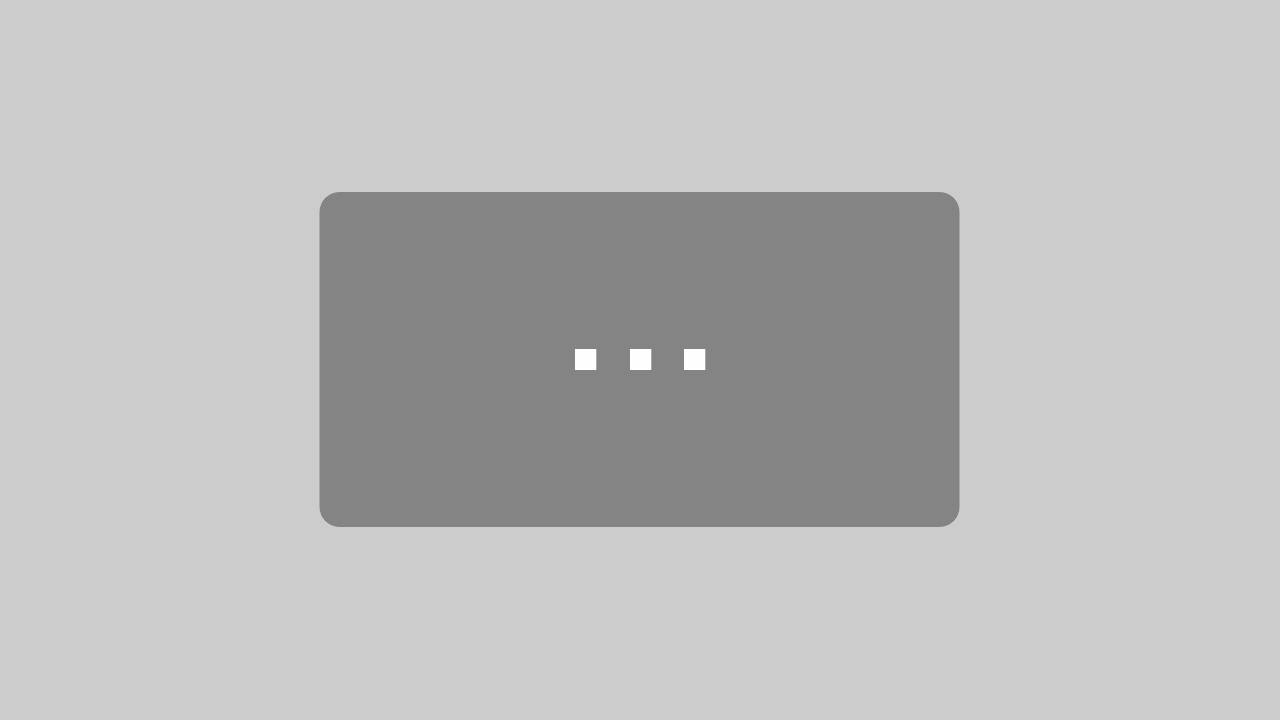



Schreibe einen Kommentar